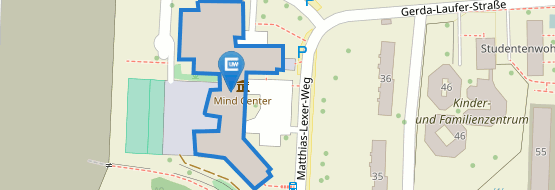Redlingshöfer, Wasserverschmutzung LLL
Konzeption, Durchführung und Evaluation eines Projekttages zum Thema Wasserverschmutzung im Lehr-Lern-Labor Biologie für die 4. Jahrgangsstufe
Konzeption, Durchführung und Evaluation eines Projekttages zum Thema Wasserverschmutzung im Lehr-Lern-Labor Biologie für die 4. Jahrgangsstufe
Autorin: Laura Redlingshöfer
betreut von: Dr. Sabine Gerstner
Die Bedeutung und Gestaltung der Umwelterziehung in der Grundschule entwickelt sich seit Jahrzehnten kontinuierlich weiter. Seit Beginn der 70er Jahre werden umweltpädagogische Aspekte durch wachsende ökologische Herausforderungen, wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust und die zunehmende Umweltverschmutzung, in den Bildungsplänen der Schulen berücksichtigt (vgl. Graf, 2016a, S. 218). Die Agenda 21 prägte eine Bildung für nachhaltige Entwicklung, die sich verstärkt an einem handlungsorientierten Ansatz ausrichtet. Den Kindern soll vermittelt werden, dass sie selbst Verantwortung tragen und durch ihr Handeln aktiv zur Lösung von Umweltproblemen beitragen können. Der Gedanke Galileis, dass man Menschen nicht belehren, sondern nur in ihrem Lernprozess unterstützen kann, steht im Einklang mit seinen wissenschaftlichen Methoden. Eigene Erfahrungen anhand von Experimenten und Entdeckungen sind damit der Grundstein des Lernens, der sich auch in den Kompetenzerwartungen des modernen Verständnisses von Bildung für nachhaltige Entwicklung widerspiegelt. Um eine effektive Umwelterziehung zu gewährleisten, sind viele PädagogInnen der Meinung, man müsse sich auf die Emotionen und Vorerfahrungen der Kinder berufen (vgl. ebd., S. 218ff.). GrundschülerInnen haben auf verschiedene Weise direkte und indirekte Bezüge zu den lokalen und globalen Umweltproblemen. Naturerfahrungen beeinflussen Kinder, da sie Fragen und Sorgen auslösen, die im Unterricht thematisiert werden müssen. Studien ergaben, dass Kinder die Auswirkungen der Umweltzerstörung bewusst wahrnehmen und ein pessimistisches Zukunftsbild entwickeln (vgl. ebd., S. 221). Kinder sind somit sehr sensibel für verschiedene Naturerfahrungen und entwickeln Ängste, die in einer effektiven Umwelterziehung ernst genommen werden müssen. Zusammengefasst haben GrundschülerInnen durch Bildung, lebensweltbezogene Erfahrungen und verschiedene Medieneindrücke bereits vielfältige Berührungspunkte mit Umweltproblematiken. Die SchülerInnen sollen im heutigen Verständnis der Umwelterziehung für Umweltschutz sensibilisiert werden, indem sie ein verantwortungsvolles Umweltverhalten zeigen.
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit diesem Ziel auseinander und beschäftigt sich mit der Konzeption und Durchführung eines Projekttages zur Sensibilisierung von GrundschülerInnen im umweltpädagogisch relevanten Bereich Wasserverschmutzung. Es soll herausgearbeitet werden, welche pädagogisch didaktischen Ansätze in einem Unterrichtsentwurf berücksichtigt werden sollen, um die Verantwortung und Handlungskompetenz der Kinder für eine nachhaltigere und umweltgerechtere Zukunft zu fördern. Es werden dabei zunächst die fachwissenschaftlichen Hintergründe beleuchtet, die Einblick in den naturwissenschaftlichen Rahmen der Unterrichtsinhalte geben sollen. In einer fachdidaktischen Analyse wird die geplante Unterrichtseinheit in den LehrplanPLUS Bayern eingeordnet und hinsichtlich ihrer Schüler- und Gesellschaftsrelevanz analysiert. Eine Darlegung der Schülervorstellungen gibt Einblick in die Erfahrungen und Vorkenntnisse der ViertklässlerInnen zum Thema Wasser und Wasserverschmutzung. In einer didaktischen Reduktion wird die Auswahl der Lerninhalte begründet, die schließlich in der Ausbildung der konkreten Lernziele für den Unterrichtsverlauf mündet. In einem extra Schwerpunkt soll die Bedeutung der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Hinblick auf die Konzeption des Projekttages im Lehr-Lern-Labor hervorgehoben werden. Nach einer theoretischen Einführung zum Nachhaltigkeitsgedanken im Kontext der Grundschule werden die zentralen Unterrichtsprinzipien in der praktischen Umsetzung beschrieben und erklärt. Auf Grundlage dieser theoretischen Ausführungen wird die methodische Umsetzung mit den verschiedenen naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen und -mitteln im Lehr-Lern-Labor erläutert, wobei speziell die Verwendung eines digitalen Forscherhefts im Hinblick auf das fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsziel Digitale Bildung kritisch hinterfragt werden soll. Für die nachfolgende Evaluation des Unterrichtsversuch werden die Ergebnisse der Mentimeter-Umfrage herangezogen, welche ein konstruktives Feedback und Verbesserungsvorschläge zur methodischen und digitalen Umsetzung ermöglichte. Das abschließende Gesamtfazit rundet die schriftliche Ausarbeitung zur Konzeption, Durchführung und Evaluation des Projekttages „Aquaventure“ im Lehr-Lern Labor Biologie zum Thema Wasserverschmutzung mit einem Ausblick für weiterführende Arbeitsthemen ab.